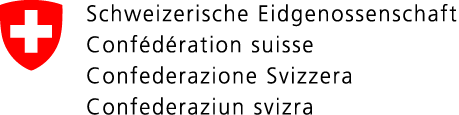Ausgangslage und Zielsetzung: In der Region Gäu-Olten im Kanton Solothurn wird seit dem Jahr 2003 ein Massnahmenprogramm in der Landwirtschaft nach Art. 62a Gewässerschutzgesetz zur Reduktion der erhöhten Nitratgehalte im Grundwasser umgesetzt. Nach Abschluss von zwei sechsjährigen Projektphasen ohne ausreichende Zielerreichung sollen in einer dritten Projektphase (2015–2020) die Wirksamkeit der Massnahmen, die auf dem sogenannten «Nitratindex» basieren, wissenschaftlich aufgearbeitet, Massnahmen zur Verbesserung der Stickstoffeffizienz und Verringerung der N-Auswaschung geprüft und Vorschläge zur Umsetzung der Ergebnisse gemacht werden. Für die Überprüfung der Massnahmen hat das Solothurner Amt für Umwelt das Projekt «Stickstoffeffizienz im Acker- und Gemüsebau für eine Reduktion des Nitrateintrages ins Grundwasser» unter der Leitung des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) in Auftrag gegeben. Als Grundlage für die Weiterentwicklung des «Nitratindex» für die Anwendung im Feldgemüsebau wurde von Agroscope eine Literaturstudie erstellt mit der Zielsetzung, (i) die Gemüsearten nach deren Nitratauswaschungspotenzial zu klassifizieren, (ii) Bewirtschaftungsmassnahmen (primär Düngung, Bewässerung, Bodenbearbeitung und Kultur-/Fruchtfolge) zur Reduktion der N-Auswaschung zu evaluieren und (iii) den Forschungsbedarf in verschiedenen Bereichen aufzuzeigen. Vorgehen und Methodik: In die Literaturstudie einbezogen wurden alle in der Schweiz im Freiland angebauten Gemüsearten, die im Mittel der Jahre 2012–2016 eine Anbaufläche von mindestens 5 ha aufwiesen. Quantitative Daten von rund 3000 Publikationen (i) zu N-Verlusten durch Auswaschung, (ii) zur N-Düngebedarf, (iii) über N-Mengen in Ernterückständen und (iv) zur Wurzeltiefe der Gemüsearten wurden zusammengestellt. Mit Hilfe der drei letzten Parameter wurde anschliessend das Nitratauswaschungspotenzial der Gemüsearten eingeschätzt. Dazu wurden die Gemüsearten für jeden Parameter in eine von vier Klassen eingeteilt, wobei die Zuordnung aufgrund des Mittelwerts (N-Düngebedarf, N-Menge in Ernterückständen) oder des Medians (Wurzeltiefe) der jeweiligen Angaben in der Literatur erfolgte. Jeder Klasse wurde eine Punktzahl von 1 (geringer) bis 4 (sehr hoher Beitrag zum Nitratauswaschungspotenzial) zugeordnet. Aus der Summe der Punkte der drei Parameter, die minimal 3 und maximal 12 beträgt, ergibt sich das Nitratauswaschungspotenzial für eine Gemüseart. Resultate: Nitratauswaschungspotenzial: Die aus der Literaturrecherche gewonnen Angaben zu N-Verlusten durch Auswaschung zeigen ungeachtet der Methodik (Lysimeter, Saugkerzen, Anion Austauschverfahren, Bodenproben, Modellierung) ein erhebliches Nitratauswaschungspotenzial unter bzw. nach Gemüsekulturen im Freiland. Beispielweise wurden mit Hilfe von Lysimetern während des Winterhalbjahrs N-Frachten von bis zu 150 kg N ha-1 gemessen. Ein Vergleich von Bodenproben aus 0–90 cm Tiefe zu Beginn des Winterhalbjahres ergab im Mittel Gehalte an mineralischem Stickstoff (Nmin) von 88 kg ha-1. Die publizierten Ergebnisse zu den Nitratfrachten eignen sich jedoch nicht oder nur bedingt für eine Differenzierung der Nitratausträge nach Gemüsearten. Dies ist begründet in der grossen Heterogenität der Versuchsbedingungen, z. B. bezüglich der gewählten Methodik, den Messparametern, der Fragestellung und der angewandten Kulturmassnahmen. Der N-Düngebedarf ergibt sich aus der Differenz zwischen dem gemüseart-spezifischen Nmin-Sollwert und dem gemessenen Nmin-Gehalt im Boden vor Kulturbeginn. Der Nmin-Sollwert repräsentiert das Nmin-Angebot, mit dem im Mittel vieler Düngungsversuche der Höchstertragsbereich gerade erreicht wird. Um Qualitätseinbussen (z. B. unzureichende Grünfärbung der Blätter) zu vermeiden, muss dabei ein Nmin-Mindestvorrat im durchwurzelten Bodenbereich bis zur Ernte vorhanden sein, denn ein grosser Teil der Feldgemüsearten wird schon zu einem Zeitpunkt geerntet, bei dem der N-Bedarf der Kulturen noch hoch ist. Die Gemüsearten wurden nach dem Nmin-Sollwert in vier Klassen eingeteilt: gering (< 150 kg N ha-1), mässig (150–200 kg N ha-1), hoch (200–250 kg N ha-1) und sehr hoch (> 250 kg N ha-1). Kohlgemüse (z. B. Rosenkohl, Kabis) weisen im Vergleich zu Blattgemüse (z. B. Nüsslisalat und Spinat) einen hohen N-Düngebedarf auf. Im Zuge der Ernte können im Freilandgemüsebau erhebliche Mengen an Ernterückständen mit entsprechend grossen Mengen an N auf dem Feld anfallen. Im Durchschnitt aller Kulturen verbleiben 118 kg N ha-1 mit den Ernterückständen auf dem Feld, wobei die Spanne von 5 bis 550 kg N ha-1 reicht. Die Gemüsearten wurden in folgende vier Klassen eingeteilt: gering (< 50 kg N ha-1), niedrig (50–100 kg N ha-1), hoch (100–200 kg N ha-1) und sehr hoch (> 200 kg N ha-1). Sehr hohe N-Mengen verbleiben im Feld mit den Ernterückständen der Kohlgemüse wie beispielsweise Rosenkohl oder Brokkoli, aber auch Zucchetti, während nach der Ernte von Blattgemüse wie Spinat oder Nüsslisalat relativ geringe N-Mengen in Form von Ernterückständen auf dem Feld zurückbleiben. Die Unterscheidung der Gemüsearten nach ihrer Wurzeltiefe ist wichtig in Bezug auf den Grundwasserschutz, weil Nitrat in tieferen Bodenschichten mehr auswaschungsgefährdet ist. Dabei lassen die wenigen verfügbaren Publikationen auf grosse Unterschiede in der Durchwurzelungstiefe zwischen den Gemüsearten schliessen. Die Gemüsearten wurden in folgende vier Klassen eingeteilt: tief- (>150 cm), mitteltief- bis tief- (100–150 cm), flach- bis mitteltief- (50–100 cm), flachwurzelnd (<50 cm). Zu den flachwurzelnden Arten gehören die Lactuca-Salate und der Nüsslisalat. Gemüsearten wie Karotten, Cichorium-Salate und Kabis wurzeln vorwiegend mitteltief bis tief. Grössere Tiefen erreichen die seltener angebauten Gemüsearten wie Schwarzwurzel und die mehrjährigen Kulturen Spargel und Rhabarber. Ein hohes Nitratauswaschungspotenzial (Punktzahl: 10–12) besteht insbesondere bei den Kohlarten (z. B. Blumenkohl, Brokkoli und Rosenkohl), während Blattgemüsearten (z. B. Salate, Spinat und Rucola) ein geringes (3–5) bis mittleres Potenzial (6–9) aufweisen. Das erhöhte Potenzial der Kohlarten beruht auf der hohen N-Düngung und den hohen N-Mengen der Ernterückstände, wobei bei Kabis die in der Literatur hervorgehobene Wurzeltiefe zur Verringerung des Potenzials beiträgt. Im Gegensatz dazu zeigt sich bei den Blattgemüsen, die zwar meist eine geringe Wurzeltiefe aufweisen, ein geringes bis mittleres Potenzial aufgrund der geringeren N-Düngung und der kleineren N-Menge, die mit den Ernterückständen auf dem Feld verbleibt. Die vorgenommene Einordnung der Gemüsearten kann in Modellen wie «Nitratindex 2.0» und MODIFFUS als Grundlage für eine Differenzierung nach dem Auswaschungspotenzial genutzt werden. Evaluation der Bewirtschaftungsmassnahmen zur Reduktion der Nitratauswaschung In der Literatur finden sich viele mögliche Massnahmen, die angewendet werden können, um die Nitratauswaschungsverluste im Freilandgemüsebau zu reduzieren. Die Fülle an Massnahmen lässt sich neun Bereichen zuordnen: 1. Bewässerung, 2. N-Düngung, 3. Frucht-/Kulturfolge, 4. Ernterückstände, 5. Bodenbearbeitung, 6. Informationsaustausch, 7. Umstellung des Anbausystems, 8. Precision farming und 9. Sonstiges. Die Bewertung der Massnahmen nach ihrem Reduktionspotenzial, dem Wissensstand und ihrer Praxistauglichkeit ergab vier Massnahmen mit einem grossen Reduktionspotenzial, die breit anwendbar und relativ kostengünstig zu implementieren sind: - Steuerung der Bewässerung: Die sachgerechte Bewässerung kann das N-Auswaschungsrisiko reduzieren und gewährleistet ein für die bestmögliche Nährstoffaufnahme der Pflanzen notwendiges Wasserangebot und somit ein optimales Pflanzenwachstum und eine hohe Produktqualität. Um den Bewässerungsbedarf der Gemüsekultur möglichst effizient und mit an das Wachstum angepassten Wassergaben zu decken, empfiehlt sich eine Steuerung der Bewässerung. Hierzu stehen primär vier verschiedene Methoden als Entscheidungshilfe zur Verfügung: (i) die klimatische Wasserbilanz (z. B. Geisenheimer Steuerung), (ii) mehrschichtige Bodenfeuchte- und Evapotranspirationsmodelle, (iii) Bodenfeuchtesensoren und (iv) das kontinuierliche Monitoring des Pflanzenbestandes durch Messungen von Pflanzeneigenschaften (z. B. Bestandestemperatur). - Verbesserte Ermittlung des N-Düngebedarfs: Bei der Düngung spielt neben der Wahl der Düngemittel und deren Ausbringung die Ermittlung des Düngebedarfs eine entscheidende Rolle. Hierzu gibt es unterschiedliche Herangehensweisen für die Bemessung. Die aussichtsreichsten sind die Nmin-Methode, das Kulturbegleitende-Nmin-Sollwert-System (KNS) und das EDV-Programm N-Expert. Beispielsweise um den N-Düngebedarf mit Hilfe der Nmin-Methode abzuschätzen, wird vor Kulturbeginn die Nmin-Menge in der von den Wurzeln nutzbaren Bodenschicht durch die Entnahme von Bodenproben gemessen. - Verbesserte Fruchtfolgen dank Anbau von Zwischenfrüchten: In Bezug auf die Optimierung der Frucht-/Kulturfolge unterscheidet man begrifflich zwischen Mischkultur, Untersaat und Zwischenfrucht. Bei der Mischkultur wird eine Zwischenfrucht als Nebenfrucht gleichzeitig mit der Hauptfrucht, bei der Untersaat einige Wochen nach der Saat und bei der Zwischenfrucht nach der Hauptkultur angesät. Die Auswahl an Kulturen, die im Spätsommer und Herbst als Zwischenfrüchte genutzt werden können, umfasst unter anderem verschiedene Gräser (z. B. Italienisches Raigras), Leguminosen (z. B. Winterwicke), Mischungen aus den letzteren (z. B. das Landsberger Gemenge), aber auch Gemüsearten (z. B. Kohlarten) und der erneute Aufwuchs bei einigen Herbstkulturen (z. B. Spinat), deren Wurzelwerk durch die Ernte nicht beschädigt wurde. Allen Zwischenfrüchten ist gemein, dass sie N aus dem Boden aufnehmen und in ihrer Biomasse speichern sowie die Sickerwassermenge durch die Wasseraufnahme reduzieren. - Optimierung des Ernterückstandmanagements: Während die Ernterückstände bis anhin vorwiegend auf den Feldern zurückbleiben, sollte in Zukunft bei Gemüsearten mit hohen N-Mengen im zurückbleibenden Pflanzenmaterial in der zweiten Jahreshälfte die Abfuhr der Ernterückstände mit nachfolgender Weiterverwertung in Vergärungs- und Kompostieranlagen in Erwägung gezogen werden. Forschungsbedarf in verschiedenen Bereichen: - Für eine Differenzierung einzelner Gemüsearten anhand von Messdaten sollten neue Studien in Auftrag gegeben werden. Aus praxisrelevanten Gesichtspunkten sollten hierbei jedoch anstatt einzelner Gemüsearten vielmehr gemüsebauliche Kultur- oder Fruchtfolgen, die typisch für die Schweiz sind, untersucht werden. - Überprüfung der aktuellen Düngungsnormen und der Verwendung von Sicherheitsmargen insbesondere im bewässerten Anbau. Angepasste Düngung in Bezug auf aktuelle Ertrags- und Qualitätserwartungen und Sortenunterschiede. Insbesondere im Serienanbau sind Jahreszeitenunterschiede im Düngebedarf zu berücksichtigen. Existierende Expertensysteme wie z. B. N-Expert sollten unter Schweizer Bedingungen getestet werden. - Für die Bodenbearbeitung im Freilandgemüsebau stehen neben dem intensiven Pflugverfahren, verschiedene Techniken für eine konservierende Bodenbearbeitung zur Verfügung. Diese Verfahren gelten als effektive Praktiken für nachhaltige Produktionssysteme, insbesondere durch ihren nachgewiesenen Beitrag zum Erosionsschutz. Jedoch bleibt die Frage, in welchem Ausmass diese Verfahren die N-Dynamik im Boden und somit die N-Auswaschung im Gemüsebau beeinflussen, derzeit unbeantwortet. Wie unsere Literaturrecherche zeigt, existieren im Gemüsebau bisher fast keine Versuche, die diese Fragestellung untersuchen. - Zur Verbesserung des Umgangs mit den Ernterückständen sollte untersucht werden, wie der auswaschungsgefährdete N im zurückbleibenden Pflanzenmaterial besser konserviert werden kann.


Gesünder essen schont Umwelt
Die Umweltwirkungen unserer Ernährung könnte um über 50 Prozent gesenkt werden, wenn sich die Schweizer Bevölkerung bedarfsgerecht gemäss Lebensmittelpyramide ernährt und weniger Nahrungsmittel wegwirft. Dies zeigen neueste Modellrechnungen von Agroscope.
Zemek O., Neuweiler R., Spiess E., Stüssi M., Richner W.
Nitratauswaschungspotenzial im Freilandgemüsebau – eine Literaturstudie.
Agroscope Science, 95, 2020.
Download german (2749 kB)
ISSN Online: 2296-729X
Digital Object Identifier (DOI): https://doi.org/10.34776/as95g
Publication-ID (Web Code): 43974 Sending by e-mail
Als Kompetenzzentrum des Bundes für die Forschung und Entwicklung im Agrar-, Ernährungs- und Umweltbereich forscht Agroscope für ein nachhaltiges, resilientes Agrar- und Ernährungssystem, für eine gesunde Ernährung mit hochwertigen Lebensmitteln und für eine intakte Umwelt zum Nutzen von Gesellschaft, Politik und Praxis. In diesem Sinne betreibt Agroscope Forschung und Entwicklung im Agrar-, Ernährungs- und Umweltbereich, stellt Entscheidungsgrundlagen für die Gesetzgebung bereit, nimmt Vollzugsaufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben im Dienste von Landwirtschaft und Allgemeinheit wahr und betreibt einen Wissensaustausch und Technologietransfer mit der Praxis, Beratung, Wirtschaft, Wissenschaft, Lehre und Öffentlichkeit – kurz: Agroscope – gutes Essen, gesunde Umwelt.
Der Gegenvorschlag des Ständerats zur Volksinitiative "Für Ernährungssicherheit" des Schweizer Bauernverbandes kam am 24. September 2017 vors Stimmvolk. Dieser sieht vor, dass für die Ernährungssicherheit ein umfassendes Gesamtkonzept in die Verfassung aufgenommen wird. Dazu gehören etwa die Sicherung des Kulturlandes, eine standortangepasste und ressourceneffiziente Lebensmittelproduktion und eine auf den Markt ausgerichtete Land- und Ernährungswirtschaft.
Agroscope forscht entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Land- und Ernährungswirtschaft und leistet so einen entscheidenden und vielseitigen Beitrag zur Ernährungssicherheit der Schweiz. Vielfältig sind die Forschungsprojekte zur Stärkung einer innovativen und wettbewerbsfähigen Land- und Ernährungswirtschaft, zum Schutz von Boden, Wasser und nicht erneuerbaren Ressourcen und zur Förderung einer nachhaltigen, risikoarmen und tiergerechten landwirtschaftlichen Produktion. Nachfolgend ausgewählte Beispiele aus dem Tätigkeitsspektrum von Agroscope zur Illustration des Agroscope-Beitrags zur Ernährungssicherheit:
Tiere
Mit dem Anwachsen der Betriebsgrössen steigen auch die Tierzahlen auf den einzelnen Betrieben. Damit erhöht sich der Überwachungsaufwand für die Tierhaltenden. Entsprechend werden technische Lösungen für eine automatisierte Tierüberwachung gesucht. Das Forschungsprojekt RumiWatch entwickelte dafür ein sensorbasiertes Monitoringsystem für die Aktivitäts- und Gesundheitsüberwachung von Milchkühen.
Das Projekt Lactobeef zeigt auf, wie im Sömmerungsgebiet über die Produktion von Rindfleisch das Problem der Gewässerverunreinigung durch überschüssige Molke aus der Alpkäseproduktion gelöst und der Verwaldung entgegengewirkt werden kann.
Die Messung von gasförmigen Emissionen mit Treibhauseffekt aus der Tierhaltung ist ein Forschungsschwerpunkt bei Agroscope. Vor zwei Jahren kaufte Agroscope dazu zwei GreenFeed-Systeme. Jetzt liegen die ersten Resultate der Methan- und die Kohlendioxid-Messungen vor.
Dank einer neuen Nachweismethode zur Früherkennung des gefürchteten und ansteckenden Euterkeims Staphylococcus aureus können Eutererkrankungen rasch und effektiv bekämpft werden (Agroscope Transfer Nr. 25).
Rund 75‘000 Tonnen Soja für die Proteinversorgung, das meiste im Ausland produziert, gelangt jährlich in die Futtertröge der Schweizer Schweine. Beim Überprüfen der Fütterungsnormen für Schweine stellten Forschende von Agroscope Erstaunliches fest: Es gibt Schweine, die mit weniger Proteinen gleiche Leistungen erzielen. Würden in der Schweiz ausschliesslich Tiere gezüchtet, die mit weniger Proteinen auskommen, könnte die Schweiz vollständig auf Sojaimporte für die Mastschweinefütterung verzichten.
Bei der Gruppen-Behandlung von Schweinen soll das Antibiotikum direkt in den Futtertrögen in das Futter eingemischt werden, um die Bildung von antibiotikaresistenten Keimen in Flüssigfütterungsanlagen zu verhindern.
Krankheitserreger und Schädlinge sind zu einem grossen Teil für die hohen Verluste von Bienenvölker verantwortlich. Das Zentrum für Bienenforschung von Agroscope erarbeitete einen Leitfaden für Bienengesundheit. Dieser dient der Erkennung, Diagnose, Prävention und Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen.
Das Schweizer Nationalgestüt SNG unterstützt landesweit eine nachhaltige, wettbewerbsfähige und artgerechte Pferdehaltung und -zucht. Ein Beispiel: Unter natürlichen Bedingungen verbringen Pferde 12 bis 18 Stunden mit der Nahrungsaufnahme. Für Hauspferde braucht es Lösungen, damit die Tiere mit der Aufnahme ihrer täglichen und an ihren Nährstoffbedarf angepasste Raufuttermenge so lange wie möglich beschäftigt sind. Auf dem Markt werden immer mehr so genannte „Slow-Feeding-Systeme“ angeboten, um die Nahrungsaufnahme zu verlangsamen. Das SNG testet, ob diese Systeme ihre Versprechen halten und praxistauglich sind.
Publikationen
Pflanzen
Im Grasland Schweiz werden Wiesenpflanzen fast ausschliesslich in Mischungen angesät. Die aktuellen klimatischen Veränderungen erhöhen das Risiko für Trockenperioden. Agroscope untersucht, welche Kombinationen an Wiesenpflanzen eine gute Leistung unter Trockenheitsstress erbringt. Erste Resultate mit Esparsette sind vielversprechend.
Die vielfältigen Forschungsresultate zur Optimierung der Anbausysteme durch Bodenbearbeitung, Fruchtfolge und Bodenbedeckung tragen wesentlich zu einem nachhaltigen und produktiven Ackerbau bei.
Die Erarbeitung und periodische Aktualisierung der fachlichen Grundlagen für die bedarfsgerechte Düngung (GRUD) dient im Pflanzenbau einer optimalen Produktion. Gleichzeitig ermöglichen die GRUD, die Ressourcen zu schonen und die Umweltbelastung durch Nährstoffverluste zu senken.
Die Züchtung und Bewertung von Getreidesorten erfordert gute Kenntnisse über Resistenz gegen Pilzkrankheiten und Anhäufung von Mykotoxinen in den Körnern. Ein Agroscope-Projekt fasst all diese Aktivitäten zusammen und stellt der Züchtung Informationen für leistungsstarke und dem Markt angepasste, gesunde Sorten zur Verfügung.
Die Züchtung von Sojasorten, welche an den Schweizer Markt und die hiesigen klimatischen Verhältnisse angepasst sind, entspricht dem Kundenwunsch nach heimischer Produktion und bekömmlichen Proteinlieferanten (Fachvideo Sojazüchtung).
Das Informations- und Prognosesystem PhytoPRE unterstützt eine gezielte Bekämpfung der Krautfäule im IP- und Bio- Kartoffelbau und erlaubt so, den Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln zu reduzieren.
Agrometeo – Agroscope bietet diese Dienstleistung als Web-App an – dient zur Vorhersage von Krankheits- und Schädlingsrisiken und damit zur Entscheidungshilfe für eine optimierte Anwendung von Pflanzenschutzmassnahmen.
Gemeinsam mit Partnern aus Bund, Kantonen, Praxis und Industrie werden vielfältige Strategien entwickelt im Hinblick auf eine langfristig Antibiotika-freie Bekämpfung der hochansteckenden Pflanzenkrankheit Feuerbrand.
Die gemeinsamen Aktivitäten der Task Force bestehend aus Bund, Kantonen, dem Forschungsinstitut für Biolandbau FiBL und der Branche dienen der Bekämpfung der Kirschessigfliege im Obst- und Beerenanbau.
Praxisempfehlungen wie die Publikationen zur Bewässerung von Obstbäumen dienen der nachhaltigen Nutzung der Ressource Wasser (Tröpfchenbewässerung).
Mit der Massnahmensammlung für die Praxis wird die Kontaminationen von Frisch- und Schnittsalaten mit antibiotikaresistenten Keimen vermieden.
Das Angebot von Produktions-Know-how für Gewürz- und Medizinalpflanzen dient der Innovation für die Produktion in Bergregionen und entspricht einer wachsenden Nachfrage von Industrie, Konsumentinnen und Konsumenten.
Dank der neuen Nachweismethode mit genetischem Fingerabdruck können Schaderreger schnell als Quarantäneorganismen erkannt und gestoppt werden. Dieses Vorgehen dient einer raschen Importabwicklung am Flughafen.
Publikationen
Wirtschaftliche Grundlagen
Mit Hilfe der Daten von jährlich über 4000 Betrieben, welche ihre Buchhaltung der Zentralen Auswertung abliefern, wird die wirtschaftliche Situation in der Landwirtschaft jährlich analysiert – ein wichtiger Beitrag in der laufenden Optimierung der agrarpolitischen Instrumente.
AgriPerform, der „Röntgenapparat“ für die Buchhaltung dient der Landwirtschaft zur Kostensenkung und erlaubt es, das Landwirtschaftliche Einkommen zu erhöhen.
Das Modellsystem SWISSland dient dazu, die Wirkung von agrarpolitischen Massnahmen, Markteinflüssen und Standortbedingungen auf die Einkommensentwicklung, den Strukturwandel und die Flächenbewirtschaftung im Schweizer Agrarsektor abzuschätzen.
Entscheidungshilfen zum Einsatz von Smart-Farming-Technologien für die Praxis erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Landwirtschaft.
Maschinen sind in einem hohen Masse für die hohen Produktionskosten der Schweizer Landwirtschaft verantwortlich. Darum errechnet Agroscope jährlich im Maschinenkostenbericht die aktuellen Richtansätze, die eine kostendeckende Nutzung der Maschinen erlauben und bietet so verlässliche Grundlagen für Investitions- und Betriebsentscheide.
Lebensmittel
Für die Herstellung von Käse, Joghurt und weiteren fermentierten Milchprodukten müssen der Milch Mikroorganismen zugesetzt werden. Die von Agroscope produzieren Liebefeld-Kulturen sind aus rund 100-jähriger Forschungstätigkeit hervorgegangen.
Agroscope hat in Zusammenarbeit mit verschiedenen Sortenorganisationen einen Herkunftsnachweis für Käse basierend auf Milchsäurebakterien entwickelt. Dieser erlaubt, im Labor die Echtheit des Käses nachzuweisen, was gerade im Exportkäsegeschäft von grosser Bedeutung sein kann.
Die Produktion von Rohmilchkäse hat in der Schweiz Tradition. Ein Problem ist dabei die Bildung von Histamin während der Reifung von Käse, da es bei Menschen Verdauungsbeschwerden auslösen kann. Agroscope konnte die für die Histaminbildung in Käse verantwortlichen Bakterien identifizieren, die Kontaminationsquellen im Verarbeitungsprozess ausfindig machen und für die Praxis wirksame Massnahmen zur Senkung des Histamingehalts von Käse entwickeln.
Mit seinem Beratungsteam für milchwirtschaftliche Kunden gibt Agroscope die neuesten Forschungsergebnisse rasch an die Praxis weiter. Umgekehrt ist das Beratungsteam in die Forschungsarbeiten integriert und stellt damit sicher, dass aktuelle Fragen aus der milchwirtschaftlichen Praxis in der Forschung bearbeitet werden.
Das Zentrum für Bienenforschung von Agroscope unterstützt die Imkerei mit wissenschaftlichen Grundlagen für die Bienenhaltung und unterstützt die Sicherung der Honigqualität.
Mit der Kontrolle von Weinen für die Ausfuhr erfüllt Agroscope eine Vollzugsaufgabe des Bundes und unterstützt die Qualitätssicherung für den Schweizer Weinexport.
Mit der Ausbildung von Brennereien wird die Qualität der Destillate verbessert und damit eine Steigerung der Wertschöpfung erreicht.
Auch zur Reduktion von Lebensmittelverlusten (Foodloss) ist Agroscope aktiv, so etwa in der Entwicklung neuer Lagermethoden von Obst.
Publikationen
Umwelt
Mit dem Humusbilanz-Rechner kann die Bewirtschaftung einfach überprüft werden, damit der Humusgehalt und die Bodenfruchtbarkeit in Ackerböden langfristig erhalten bleiben.
Im Monitoringprogramm «Arten und Lebensräume Landwirtschaft» (ALL-EMA) messen Fachleute den Zustand und die Veränderung der Biodiversität in der Schweizer Agrarlandschaft.
Das Hauptziel der Nationalen Bodenbeobachtung NABO ist die landesweite Erfassung und Beurteilung von chemischen, physikalischen und biologischen Bodenbelastungen. Weiter gehören auch Prognose und Früherkennung von Veränderungen zu ihren Aufgaben, um die Fruchtbarkeit der Böden dauerhaft zu sichern.
Als Alternative in der Schädlingsbekämpfung fördern Nützlings-Blühstreifen die biologische Schädlingskontrolle und die Bestäubung und tragen zu einer nachhaltigen, produzierenden Landwirtschaft bei.
SALCA (Swiss Agricultural Life Cycle Assessment) ist eine Ökobilanzmethode und -datenbank, welche von Agroscope entwickelt wurde. Sie dient der Analyse und Optimierung der Umweltwirkungen der landwirtschaftlichen Produktion.
Aufgaben für den gesetzlichen Vollzug
Agroscope wirkt mit bei einer effizienten und wirksamen Erfüllung der Kontroll- und Vollzugsaufgaben der Landwirtschaftsgesetzgebung sowie bei weiteren, die Landwirtschaft direkt tangierenden Gesetzen. Dabei trägt Agroscope dem Schutz von Bevölkerung und Umwelt, der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Produkte auf dem Binnenmarkt sowie der Erhaltung der Exportfähigkeit besonders Rechnung und berücksichtigt die national und international gültigen Normen.
Beispiele von Vollzugsaufgaben sind:
Futtermittel: Agroscope ist für die Bewilligung und die Kontrolle von Produkten sowie die Meldung, Zulassung und Registrierung von Produzenten und Inverkehrbringern zuständig.
Im Auftrag des Bundesamtes für Landwirtschaft BLW liefert Agroscope wissenschaftliche Grundlagen für eine fundierte Nutzen-Risiko-Beurteilung von Pflanzenschutzmitteln.
Anerkennung von Saatgut, Sortenprüfung, Sortenschutz im Feldbau/Futterbau.
Düngungsrichtlinien für Acker- und Spezialkulturen sowie den Futterbau.
Ermittlung der wirtschaftlichen Lage der Landwirtschaft über die zentrale Auswertung der Buchhaltungsdaten.
Baulicher Gewässerschutz in der Landwirtschaft.
Foren und Gremien von Agroscope
Die Kompetenzbereiche für Forschungstechnologie und Wissensaustausch von Agroscope richten ihre Tätigkeit auf Praxisanliegen aus. In diesem Zusammenhang spielen Extension-Projekte, wie Agroscope sie im Obstbau kennt, oder die Praxis-Foren – zurzeit gibt es 20 – eine wichtige Rolle.
Mehr zum Thema Ernährungssicherheit und zum Gegenentwurf zur Volksinitiative „Für Ernährungssicherheit“ finden Sie hier:
Hintergrundinformationen zur Ernährungssicherheit
Film zur Volksabstimmung vom 24. September 2017 Ernährungssicherheit
Gegenentwurf zur Volksinitiative „Für Ernährungssicherheit“
Die Schweiz setzt sich im Rahmen der FAO für Ernährungssicherheit ein