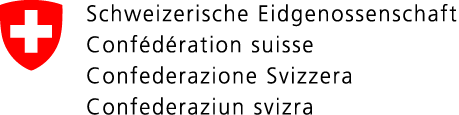Dieses SFF verfolgt drei Ziele:
- Monitoring der Biodiversität in der Agrarlandschaft und Evaluation der Massnahmen zu ihrer Erhaltung auf den Skalen Parzelle, Betrieb und Landschaft.
- Entwicklung von Strategien zur Förderung von Nutzorganismen (z.B. Bestäuber, Antagonisten, Destruenten), artenreicher Bestände und Anbausysteme, welche Ökosystemdienstleistungen erbringen.
- Verbesserung der Effizienz des ökologischen Ausgleichs und von Bewirtschaftungsmassnahmen auf Parzellen- und Betriebsebene zur Erreichung der Umweltziele Landwirtschaft und zur Unterstützung der Biodiversitätsstrategie des Bundes unter Berücksichtigung des Klimawandels.
Daraus leiten sich die folgenden Forschungsfragen ab:
Monitoring der Biodiversität
- Wie kann ein Monitoring kostengünstig und effizient gestaltet werden, so dass ein grosser Mehrwert für Behörden und Landwirtschaft entsteht (Entscheidungsgrundlagen)? (Frage 1.4 angehängt) Mit welchen neuen Messtechniken (Fernerkundung, automatisierte Erhebungen, Labormethoden wie Metagenomics) kann das Kosten-Nutzen-Verhältnis von ALL-EMA verbessert werden?
- Welche Indikatoren können aus den gegenwärtig erhobenen Daten abgeleitet werden? Wie können Synergien geschaffen werden zwischen ALL-EMA, BDM, Arealstatistik, Brutvogelmonitoring Schweiz, AGIS-Datenbank?
- Mit welchen Biodiversitätsindikatoren (zusätzliche faunistische Gruppen) kann das bestehende Agrarumweltmonitoring ergänzt werden?
- Wie kann die Biodiversität als Wirkungskategorie in Ökobilanzen besser abgebildet werden?
Förderung von Nutzorganismen und Ökosystemdienstleistungen
- Wie müssen Blühstreifen im Ackerbau ausgestaltet sein, so dass Bestäuber und Prädatoren gezielt gefördert werden und haben Blühstreifen und andere BFF eine Wirkung auf den Ertrag von Kulturpflanzen?
- Ist die Bestäubung der Kulturpflanzen gesichert, welche auf Insektenbestäubung angewiesen sind?
- Welche Ansprüche haben Bestäuber und Nützlinge an die Raumausstattung der Agrarlandschaft, damit sie ihre Ökosystemdienstleistung in den landwirtschaftlichen Kulturen erbringen können?
- Welche Ökosystemdienstleistungen erbringen BFF und Grenzertragsstandorte?
- Wie können mit neuen Kulturen und Anbausystemen (z.B. Körnerleguminosen, Agroforstsysteme, Kulturen wechselfeuchter Standorte) verstärkt Ökosystemdienstleistungen erbracht werden?
- Welche Chancen und Risiken ergeben sich durch neue Technologien (z.B. Biotechnologie, Genome Editing, RNAi, Gene Drive) oder den Einsatz von Makroorganismen im Pflanzenschutz für Ökosystemleistungen und insbesondere die Biodiversität?
Verbesserung des ökologischen Ausgleichs
- Wie kann der ökologische Ausgleich weiterentwickelt werden so dass ein grösserer Anteil von Umwelt-Ziel- und Leitarten erhalten und gefördert wird?
- Welche Bedeutung haben schädliche Pflanzen (z.B. invasive Neophyten, Giftpflanzen) in Agrarlandschaften und auf Biodiversitätsförderflächen?
- Wie kann die Biodiversität des Graslandes im Berggebiet erhalten werden und welche Auswirkungen haben neue Bewirtschaftungsmethoden (Bewässerung, Silobereitung, Laubbläser, usw.) sowie der Klimawandel?
- Wie müssen BFF, Ackerflächen und Graslandbestände unterschiedlicher Intensität räumlich angeordnet sein, damit die Arten- und Habitatvielfalt optimal gefördert wird?
- Wie lassen sich die Futterpräferenzen und das Bewegungsverhalten verschiedener Weidetiere kombinieren um die Erhaltung der Arten- und Habitatvielfalt mit einer wirtschaftlichen landwirtschaftlichen Produktion zu kombinieren?