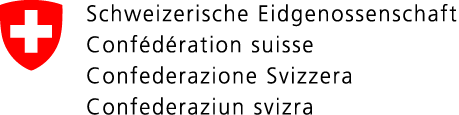Demzufolge haben traditionelle Agroforstsysteme unabhängig des Typs, der Region und der Zusammensetzung das Potenzial, einen bedeutenden Beitrag im Boden-, Klima- und Gewässerschutz – also den regulierenden Umweltleistungen zu liefern.

Bereits nach sieben Jahren bewirkte das Agroforstsystem (Apfelbäume und Ackerkultur) in der Zentralschweiz eine substanzielle Humusanreicherung von 18 Prozent, verglichen mit der kultivierten Fläche, und dies nicht nur im Oberboden, sondern bis in eine Tiefe von 60 cm.
Hingegen wurden Wurzelkonkurrenzen zwischen Ackerkultur und Baumstreifen in einem 8-jährigen Agroforstsystem (Ansaatwiese, Apfel- und Birnbäume) nicht gefunden. Durch die Bodenbearbeitung im Ackerland wurzelten die Bäume ausschliesslich im Baumstreifen sowie in tieferen Bodenschichten.

Die Bestäuberarten Bombus terrestris (Dunkle Erdhummel) und Osmia bicornis (Rote Mauerbiene) im Schwarzbubenland (Kanton Solothurn und Basel Landschaft) profitierten von Agroforstsystemen mit Kirschbäumen und extensiver Wiese als Unternutzung vom Nahrungsangebot über eine grosse Zeitspanne im Jahr und fördern die untersuchten Populationen.

Eine Tool-Box zur Modellierung von Umweltleistungen der Agroforstsystemen innerhalb einer Landschaft wurde am Beispiel des Hochstamm-Feldobstanbaus im Schwarzbubenland entwickelt.
Publikationen
Multimedia
SRF, Schweiz aktuell, 05.07.2010: Hochstammbäume: Eine alte Form von Landwirtschaft
Ansprechperson