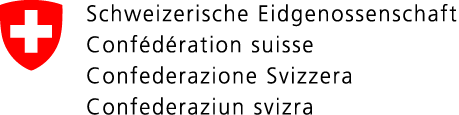Methan und Lachgas entstehen aufgrund von biochemischen Prozessen, die auch in natürlichen Ökosystemen vorkommen. Die landwirtschaftliche Produktion ist ebenfalls eine Quelle dieser Treibhausgase und kann die entsprechenden Emissionen deutlich erhöhen. Doch was bewirken diese Treibhausgase, wie entstehen sie und wie vermeidet man sie?
Gemäss dem nationalen Treibhausgasinventar ist der Landwirtschaftssektor für ungefähr 14 Prozent der Treibhausgasemissionen der Schweiz verantwortlich (Jahr 2022; FOEN, 2024). Diese Angaben beziehen sich auf den Umfang des Landwirtschaftssektors, wie er vom Zwischenstaatlichen Sachverständigenrat für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change) IPCC für die nationalen Treibhausgasinventare vorgegeben wird (IPCC, 2006). Anders gesetzte Systemgrenzen können zu leicht anderen (meist höheren) Werten führen.

© BAFU
Gemäss dem nationalen Treibhausgasinventar ist die Landwirtschaft in der Schweiz für 86 Prozent der Methanemissionen (CH4) und 64 Prozent der Lachgasemissionen (N2O) verantwortlich (FOEN 2024).

© BAFU

© Agroscope
Unter dem Übereinkommen von Paris haben sich die Vertragsparteien auf eine gemeinsame Umrechnungsmetrik für die verschiedenen Treibhausgase geeinigt (The global warming potential GWP, United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, 2018). Für die Berichterstattung unter der UNFCCC sollen die Werte für das Treibhausgaspotential (GWP100) des fünften Sachstandsbericht des IPCC (IPCC, 2013) verwendet werden. Demgemäss trägt ein Kilogramm Methan über einen Zeitraum von hundert Jahren gemittelt 28-mal stärker zur Klimaerwärmung bei als ein Kilogramm Kohlenstoffdioxid (CO₂). In der Schweizer Landwirtschaft entsteht Methan vor allem in der Milch- und Viehwirtschaft, bei der Verdauung von faserreichem Futter im Pansen von Wiederkäuern (Kühe, Rinder, Schafe und Ziegen) und bei der flüssigen Lagerung von Hofdüngern. Der klimaerwärmende Effekt von Lachgas ist ungefähr 265-mal so stark wie derjenige von Kohlenstoffdioxid. Lachgas entsteht überall da, wo Stickstoff umgesetzt wird, bei der Lagerung von organischen Düngern und Hofdüngern und insbesondere bei der Ausbringung von stickstoffhaltigen Düngemitteln.
Von 1990 bis 2004 waren die Methanemissionen um 8,5 Prozent rückläufig (FOEN, 2024). Nach 2004 stiegen die Methanemissionen kurzzeitig an, wonach sich der Trend wieder umkehrte. Im Jahre 2022 lagen die Methanemissionen rund 10 Prozent unter dem Niveau von 1990. Die Lachgasemissionen weisen einen ähnlichen Trend auf, wobei der Rückgang bis 2004 mit 20 Prozent deutlich stärker ausfiel. Seit 2004 sind die Lachgasemissionen kaum mehr gesunken und lagen im Jahr 2022 23 Prozent unter dem Niveau von 1990.

© BAFU
Die Reduktion der Methanemissionen ist vor allem auf Zuchterfolge und die Intensivierung der Produktion zurückzuführen. Dies führte vor allem zu einer Erhöhung der Energiedichte und zu einem Ausgleich des Nährstoffverhältnis der Futterration und somit zu einer Erhöhung der Fütterungseffizienz. Die Tierbestände konnten so trotz konstanter oder sogar leicht ansteigender Produktion reduziert werden. Die durchschnittliche Kuh produziert heute rund 48 Prozent mehr Milch als vor dreissig Jahren. Sie stösst deshalb auch 21 Prozent mehr Methan aus und scheidet 11 Prozent mehr Stickstoff aus. Die Emissionen pro Liter Milch nahmen jedoch um fast einen Fünftel ab (FOEN 2024).
Die Einführung des Ökologischen Leistungsnachweises anfangs der 90er Jahre führte zu einer Reduktion der eingesetzten Stickstoffmengen (Hofdünger und Handelsdünger) und somit zu signifikant tieferen Lachgasemissionen. Die Stickstoffeffizienz liess sich damit massgeblich steigern.
Sowohl bei der Milchleistungssteigerung als auch bei der Stickstoffverwertung sind der Effizienzverbesserung gewisse biophysikalische Grenzen gesetzt. Weitere Fortschritte sind zwar noch möglich, werden aber immer schwieriger erreichbar. Entsprechend wurden in den letzten 10 Jahren nur noch wenige Fortschritte erzielt.
Praxistaugliche Massnahmen mit grosser Reduktionswirkung über 20 Prozent gibt es kaum. Massgebliche Reduktionsleistungen können jedoch mit einer Kombination von kleineren Massnahmen erreicht werden (Bretscher et al., 2018). Dazu gehören zum Beispiel:
- Züchtung hinsichtlich effizienter und standortangepasster Produktion und gleichzeitig tiefer Methanemissionen,
- Optimierung der Fütterung und Einsatz von Futtermittelzusätzen,
- gesunde, leistungsfähige und langlebige Kühe,
- Herdenmanagement (Fruchtbarkeit, Zwischenkalbzeit, Verhältnis Milch- und Fleischrassen),
- emissionsarme Hofdüngerlagerung (Abdeckung, Biogasanlage).
Die Umsetzung von vielen Massnahmen auf Schweizer Praxisbetrieben ist oft herausfordernd. Organisatorische und strukturelle Hemmnisse, hohe Kosten sowie mangelndes Knowhow können dazu führen, dass sich die theoretisch möglichen Reduktionspotentiale nicht oder nur teilweise in die Praxis umsetzen lassen (z.B. Zosso et al. 2024).

© Agroscope
Eine Ration mit Futterpflanzen, die reich an Polyphenolen, insbesondere an Tanninen, sind, kann die Methanemissionen reduzieren. Allerdings liegt die erforderliche Menge solcher Pflanzen in der Regel weit über dem, was unter Praxisbedingungen realistisch ist.
Weiterhin könnten die Wiederkäuer mit extrudierten Leinsamen oder anderen fetthaltigen Futtermitteln gefüttert werden, womit die Methanproduktion im Pansen gedrosselt werden kann. Um eine signifikante Emissionsreduktion zu erreichen, sind in der Regel jedoch grössere Mengen erforderlich, was diese Massnahmen aus ökonomischen Gründen oft unattraktiv macht. Ausserdem ergibt sich aus dem Anbau von Leinsamen als Futtermittel ein Zielkonflikt hinsichtlich Flächenbedarf für die Nahrungs- und Futtermittelproduktion.
Verschiedene Futtermittelzusätze auf Basis ätherischer Öle und anderer Pflanzenextrakte, können gegebenenfalls Methanemissionen senken und/oder die Fütterungseffizienz erhöhen. Bisher konnten jedoch nur in Einzelfällen signifikante und langandauernde Effekte im Tier nachgewiesen werden.
Mit bestimmten synthetischen Futtermittelzusätzen (z.B. 3-Nitrooxypropanol, abgekürzt 3-NOP) lassen sich Methanemissionen signifikant reduzieren. Die methansenkende Wirkung von 3-NOP konnte in zahlreichen Versuchen belegt werden. Allerdings fehlt es auch hier an verlässlichen Langzeitstudien. Zudem bestehen Vorbehalte hinsichtlich der Übertragbarkeit der Forschungsergebnisse auf Schweiz-typische Rassen und graslandbasierte Produktionssysteme. Um die erzielte Wirkung zu erreichen, kann 3-NOP derzeit effektiv nur in Futtermischrationen bei Stallhaltung eingesetzt werden.
Mit einem ausgewogenen Protein/Energie-Verhältnis in der Futterration kann die Ausscheidung von überschüssigem Stickstoff in den Hofdüngern vermieden werden. Dies kann zu einer höheren Stickstoffeffizienz und zu tieferen Lachgasemissionen beitragen (Schrade et al., 2023). Ein geeigneter und leicht zugänglicher Indikator dafür ist der Harnstoffgehalt der Milch. Eine sorgfältige Planung der Fütterung ist zu empfehlen.
Gewisse Futterzusätze können auch die nützlichen Mikroorganismen im Pansen von Wiederkäuern beeinflussen bzw. hemmen. Diese sind für eine optimale Verdauung und Verwertung der natürlichen Futterressourcen, insbesondere der Fasern z.B. aus Gras und Heu, verantwortlich. Dadurch kann die Produktion gegebenenfalls sinken, was bedeutet, dass wegen der geringeren Leistung pro Liter Milch oder Kilo Fleisch insgesamt nicht weniger Methan und Lachgas freigesetzt werden. Diese Aspekte werden in der Regel in Fütterungsversuchen sorgfältig geprüft, bevor ein Futtermittelzusatz für den Einsatz in der Praxis empfohlen wird. In jedem Fall ist auf eine sorgfältige Dosierung zu achten, zudem sollten die Leistungsparameter der Tiere kontinuierlich überwacht werden.
Wiederkäuer stossen von Natur aus Methan aus. Die weltweite Zunahme der Zahl der Wiederkäuer vor allem in den letzten 200 Jahren hat zu einer starken Erhöhung der Methankonzentration in der Atmosphäre und somit zu einer globalen Temperaturerhöhung beigetragen (Reisinger und Clark, 2018). Bei weltweit konstanten Methanemissionen erhöht sich die globale Temperatur aufgrund der Kurzlebigkeit von Methan zwar nur wenig. Gleichzeitig bleibt aber auch ein wirkungsvoller und schneller «Kühlungseffekt» ungenutzt, solange die Methanemissionen nicht reduziert werden.
Zudem trägt vor allem die intensive Produktion von Kraftfutter und der Einsatz von Stickstoffdüngern zu erheblichen Kohlenstoffdioxid- und Lachgasemissionen bei.
Das Ausmass und die Form der heutigen Tierhaltung sind eine Folge der historischen Entwicklung des globalen Agrar- und Ernährungssystems. Verantwortlichkeiten können somit nicht auf einzelne Akteure bezogen werden. Gleichzeitig haben aber alle Akteure eine konkrete Eigenverantwortung, zur Lösung des Klimaproblems beizutragen.
Grundsätzlich sollten Wiederkäuer in erster Linie raufutterbasiert auf nicht-ackerbaufähigem Dauergrasland gehalten werden, und ergänzend Nebenprodukte der Lebensmittelherstellung verwerten. So würden sie Ressourcen nutzen, die nur ihnen zugänglich sind. Ackerflächen sollten bevorzugt zur Erzeugung von Produkten für die direkte menschliche Ernährung genutzt werden (Schweizerischer Bundesrat, 2022). Alternative Nutzungen (z.B. Futterproduktion) soll es geben, wenn dies im Rahmen der Fruchtfolge für die Bodenfruchtbarkeit erforderlich ist (Schweizerischer Bundesrat, 2022). Im Zusammenhang mit Treibhausgasemissionen ist da die wichtige Rolle der Ansaatwiesen für die Erhaltung der Humusgehalte, d.h. des Kohlenstoffbestandes, der Ackerböden zu betrachten (Guillaume et al., 2022). Gesamtschweizerisch bedingt diese Strategie eine Reduktion des Wiederkäuerbestandes im Vergleich zum aktuellen Stand. Auf diese Weise würden die Methanemissionen pro Liter Milch zwar etwas höher ausfallen, die Gesamtemissionen wären aber aufgrund der geringeren Tierzahlen trotzdem tiefer (z.B. Schader et al., 2015). Zudem können die relativ hohen Kohlenstoffvorräte in Böden des Dauergraslandes erhalten werden. Ein für die Humusbilanz des Bodens sinnvoller Hofdüngereinsatz und die Verwertung der Nebenprodukte des Ackerbaus werden dabei die Zusammenarbeit zwischen Wiederkäuerhaltung und Ackerbau weiterhin erfordern.

© Agroscope
Verschiedene Lebensmittel haben sehr unterschiedliche Treibhausgasfussabdrücke (Poore and Nemecek, 2021). Treibhausgasfussabdrücke von tierischen Lebensmitteln und insbesondere von Fleisch von Wiederkäuern liegen in der Regel um ein Vielfaches über denjenigen von pflanzlichen Produkten.
Handlungsspielraum liegt daher auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten, die über ihren Speisplan ihren Ernährungsfussabdruck massgeblich beeinflussen können. Mit einer Ernährung gemäss der Lebensmittelpyramide (LMP) könnte der mittlere ernährungsbedingte Treibhausgasfussabdruck in der Schweiz um ungefähr die Hälfte gesenkt werden (Zimmermann et al., 2017).

Eine Reduktion der Lebensmittelverschwendung (Food-Waste) wäre ein weiterer grosser Beitrag zum Klimaschutz im Rahmen des Ernährungssystems.
Zudem sollte der Konsum von saisonalen und lokalen Produkten gefördert werden, um lange Transportwege (einschliesslich Lagerung und Kühlung) zu vermeiden und die klimaschädliche Produktion von Nahrungsmitteln in anderen Regionen der Erde zu verringern.

Quellen
Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, Deutschland:
https://www.landwirtschaft.de/landwirtschaft-verstehen/haetten-sies-gewusst/tierhaltung/wie-viel-milch-geben-schafe-und-ziegen
FOEN 2025: Switzerland’s Greenhouse Gas Inventory 1990–2023: National Inventory Document and reporting tables (CRF). Submission of April 2025 under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Federal Office for the Environment, Bern.
www.climatereporting.ch
Guillaume, T., Makowski, D., Libohova, Z., Elfouki, S., Fontana, M., Leifeld, J., ... & Sinaj, S. (2022). Carbon storage in agricultural topsoils and subsoils is promoted by including temporary grasslands into the crop rotation. Geoderma, 422, 115937.
Hegarty, R.S., Passetti, R.A.C., Dittmer, K.M., Wang, Y., Shelton, S., Emmet-Booth, J., Wollenberg, E., McAllister, T., Leahy, S., Beauchemin, K., Gurwick, N. 2021
An evaluation of emerging feed additives to reduce methane emissions from livestock.
2021 Edition 1. A report coordinated by Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS), New Zealand Agricultural Greenhouse Gas Research Centre (NZAGRC), Global Research Alliance (GRA).
IPCC 2006: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Intergovernmental Panel on Climate Change.
www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp.
IPCC 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)
IPCC 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
DOI: 10.1017/9781009157896
Klimastrategie Landwirtschaft und Ernährung 2050
https://www.blw.admin.ch/de/klimastrategie-landwirtschaft-und-ernaehrung-2050
Reisinger, A., Clark, H. 2018: How much do direct livestock emissions actually contribute to global warming? Global Change Biology, Vol: 24/4: 1749-1761. doi:10.1111/gcb.13975
Schader, C., Muller, A., Scialabba, N. E.-H., Hecht, J., Isensee, A., Erb, K.-H., Smith, P., Makkar, H. P. S., Klocke, P., Leiber, F., Schwegler, P., Stolze, M., Niggli, U. 2015: Impacts of feeding less food-competing feedstuffs to livestock on global food system sustainability. Journal of The Royal Society Interface, Vol: 12/113: 10.https://doi.org/1098/rsif.2015.0891
Schrade, S., Zeyer, K., Mohn, J., Zähner, M. 2023: Effect of diets with different crude protein levels on ammnonia and greenhouse gas emissions from a naturally ventilated dairy housing, Science of the Total Environment, Vol. 896. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165027
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung, Die Schweizer Lebensmittelpyramide - ausgewogene Ernährung
Schweizerischer Bundesrat, 2022: Zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik. Bericht des Bundesrates in Erfüllung der Postulate 20.3931 der WAK-S vom 20. August 2020 und 21.3015 der WAK-N vom 2. Februar 2021.
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/72187.pdf
UNFCCC 2018: Decision 18/CMA.1: Modalities, procedures and guidelines for the transparency framework for action and support referred to in Article 13 of the Paris Agreement.
https://unfccc.int/resource/tet/0/00mpg.pdf
Kontakt
Weitere Informationen
Letzte Änderung 18.07.2025