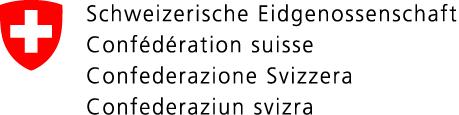Proteineffizienz und Futtereffizienz sind nicht dasselbe. Die Futteraufnahmemenge wird hauptsächlich vom Energiegehalt gesteuert, weshalb eine Zucht auf Futterverwertung hauptsächlich die Energieeffizienz erhöht. Von den mit der Nahrung aufgenommenen Proteinen wird ca. 40% im Schlachtkörper fixiert und kann als Fleisch verwertet werden. Der Rest fällt entweder in Form von Schlachtabfällen oder als Stickstoffverbindungen in Hofmist und Gülle an. Die Schäden, die reaktive Stickstoffverbindungen anrichten, sind bekannt. Vor allem Wasser, Luft, Erderwärmung, Ökosysteme und Boden sind betroffen. Die Eiweissträger für die Schweineernährung werden ausserdem oft von weit her importiert, was zu weiteren negativen Umweltwirkungen führt. Mögliche Abhilfestrategien zielen auf das Güllemanagement ab, wie z. B. geschlossene Nährstoffkreisläufe, wie sie in der Schweiz per Verordnung schon seit 1998 praktiziert werden. Andere Ansätze beziehen sich direkt auf die Schweine, wie z.B. die Mehrphasenernährung. Die Genetik kann sicherlich auch zur Bewältigung der Stickstoffproblematik beitragen, indem man durch Zucht die durchschnittliche Proteineffizienz der Schweine erhöht. An Agroscope läuft seit März 2019 ein Projekt, das die Grundlagen für eine solche Zucht erarbeitet. Dazu wurde die Proteineffizienz von fast 700 Schweinen mit Futterautomaten und einem Röntgenscanner gemessen. Mit Hilfe der Dualenergie-Röntgen-Absorptiometrie wurde der Magerfleischanteil und somit der Proteingehalt des Schlachtkörpers bestimmt. Zusätzlich wurden Fleischqualitätsmerkmale aufgenommen, aber auch Mastzuwachs und Futterverwertung. Die Vererbbarkeit der Proteineffizienz liegt bei 39% und lässt eine vielversprechende genetische Basis dieses Merkmals vermuten. Die genetischen Korrelationen mit den meisten Fleischqualitätsmerkmalen sind null, was darauf hindeutet, dass keine Veränderung der Fleischqualität bei Zucht auf Proteineffizienz zu erwarten ist. Beim Mastzuwachs sehen wir jedoch eine unvorteilhafte genetische Korrelation. Erfreulicherweise ist zu erwarten, dass die Zucht auf Proteineffizienz die Futterverwertung verbessern und die Futteraufnahme reduzieren wird. In den nächsten Schritten werden wir an der Verbesserung der Phänotypisierungsstrategie zur Vereinfachung der Messung der Proteineffizienz arbeiten sowie eine genomweite Assoziationsstudie durchführen, um Orte im Genom zu finden, die mit Proteineffizienz in Zusammenhang stehen. Zusammenfassend kann ich eine vorsichtig-optimistische Antwort auf die Frage "Wie realistisch ist die Zucht von proteineffizienten Schweinen?" geben. Das Merkmal ist wichtig, da dringender Handlungsbedarf besteht, die Stickstoffemissionen der Landwirtschaft zu senken. Das Merkmal ist auch messbar, wobei hier durchaus Verbesserungspotential besteht. Schliesslich finden wir eine vielversprechende Vererbbarkeit, das genetische Potential ist eindeutig vorhanden. Die Zucht ist jedoch kein Wundermittel, das alle Umweltprobleme beseitigen kann und andere Möglichkeiten zur Senkung der Stickstoffemissionen sollten zusätzlich ausgeschöpft werden.
Wie realistisch ist die Zucht von proteineffizienteren Schweinen?
In: Kongress zur Zucht von Rind und Schwein - Landwirtschaft und Wissenschaft gestalten die Zukunft. 06. Oktober, Berlin, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. 2021, 1-13.
Link: Programm der Konferenz
Publication-ID (Web Code): 47510 Sending by e-mail