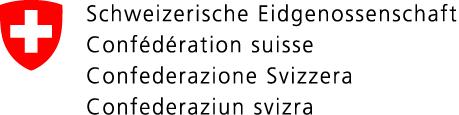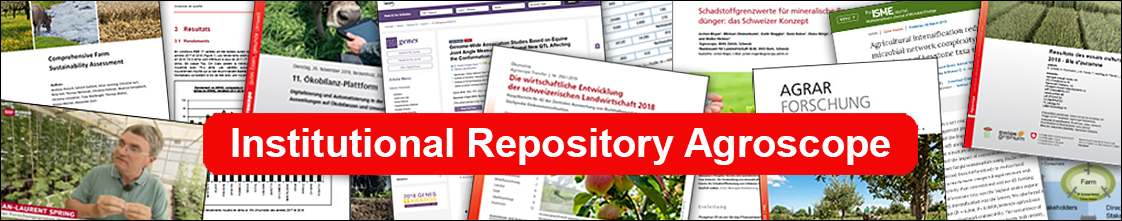Der Einsatz von Automatischen Melksystemen (AMS) ist in einigen Sortenorganisationen von AOP-Käse erlaubt, in anderen jedoch verboten, da ein Imageschaden für die Branche und die Milchqualität befürchtet wird. Ihre Einführung kann die Betriebsführung beeinflussen, insbesondere was die Weidehaltung der Kühe betrifft. Ziel dieser Studie ist es, die Auswirkungen von AMS auf die Milchqualität, den Bezug zur Ursprungsregion, die bakterielle Biodiversität, soziale Aspekte und das Image zu bewerten. Die Erkenntnisse sollen das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Ergebnisse werden dazu beitragen, die gesetzliche Grundlage für die Registrierung von Käse und Milchprodukten als AOP-Produkte zu stärken. Sowohl frühere Studien als auch die wissenschaftliche Literatur weisen darauf hin, dass mit AMS gesammelte Milch im Vergleich zu Milch aus konventionellen Melkständen (Melken 2x/Tag) durchwegs einen höheren Anteil an freien Fettsäuren aufweist. Zu dieser Freisetzung von Fettsäuren kann es durch mikrobielle, induzierte oder spontane Lipolyse kommen. Im ersten Teil dieser Studie wurden die verfügbaren Daten zum Gehalt freier Fettsäuren untersucht, die zwischen 2017 und 2024 im Rahmen der amtlichen Milchprüfung bei 73 Produzenten von silofreier Milch der Produktionskette von Emmentaler AOP gesammelt wurden. Heute setzen alle diese Produzenten ein AMS ein, 50 von ihnen haben das System aber während des Untersuchungszeitraums installiert. Die Ergebnisse zeigen, dass bei 22 Produzenten der Gehalt an freien Fettsäuren signifikant anstieg, während er in 9 Betrieben signifikant abnahm. Im zweiten Teil der Studie wurden 46 Milchproduzenten mit AMS ausgewählt und dann einzeln besucht, um vor Ort Daten in den Betrieben zu sammeln. Der Fragebogen umfasste verschiedene Parameter zur Tierhaltung und dem Betriebsmanagement sowie zur Installation, zu den eingesetzten Komponenten, Einstellungen und Melkdaten des AMS. Der Fokus der Datenerhebung lag bei den Faktoren, die die Milchqualität beeinflussen könnten. Auch die Stall- und Tierhygiene wurde berücksichtigt. Bezüglich der Haltung bestätigte sich, dass sich AMS und Weide kombinieren lassen, wenn die betrieblichen Voraussetzungen gegeben sind (arrondierte Weideflächen). 89% der besuchten Betriebe praktizierten den Weidegang zu Blockzeiten oder mittels Steuerung mit einem Weidetor. Im dritten Teil der Studie schliesslich wurden im Winter 2024 bei denselben 46 Produzenten mit AMS sowie bei 46 anderen Milchproduzenten mit traditionellen Melkständen, die alle zu denselben Käsereien gehörten, jeweils drei Milchproben entnommen. Es wurde der Gehalt an Capronsäure und Buttersäure bestimmt. Aufgrund der Werte dieser Analysen und der Ergebnisse der Milchprüfung wurden die 46 AMS-Betriebe nach dem Grad der Lipolyse in drei Gruppen eingeteilt (gering, mittel und stark). Die Daten für jeden Parameter wurden in den drei Gruppen verglichen. Obwohl alle Parameter des Betriebs und der Anlage für die Aufrechterhaltung einer guten Milchqualität wichtig sind, zeigen nur die Anzahl der Milchkühe (Mittelwerte der 3 Gruppen: geringe Lipolyse 48, mittlere Lipolyse 42, starke Lipolyse 39) und die Milchmenge pro Kuh und Melkung (Mittelwerte der 3 Gruppen: geringe Lipolyse 10,7 kg, mittlere Lipolyse 9,5 kg, starke Lipolyse 9,7 kg) einen leicht signifikanten Unterschied. Bei allen anderen untersuchten Parametern bezüglich AMS und Melkdaten konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Beim Vergleich der Melksysteme waren beim 25. Perzentil des Buttersäuregehalts nach 24 Stunden hochsignifikante Unterschiede festzustellen (T-Test, P-Wert <0,0001). Bei den AMS lag der durchschnittliche Gehalt bei 76 mmol/kg, während Milch konventioneller Melkstände einen Gehalt von etwa 57 mmol/kg aufwies. Durch die Studie konnte jedoch nicht festgestellt werden, welche Faktoren eine entscheidende Rolle bei der Erhöhung des Gehalts freier Fettsäuren spielen. Parallel dazu wurde die bakterielle Biodiversität in der Milch aus den 46 AMS und 46 Melkständen durch Sequenzierung der Gene, die für 16S-rRNA kodieren, bestimmt. Sowohl der Shannon-Index als auch die bakterielle Belastung zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Bei der Analyse der relativen Häufigkeit der Bakterienarten fiel auf, dass der Gehalt an Krankheitserregern, die Mastitis verursachen können, in Betrieben mit Melkstand tendenziell höher war. Die Häufigkeit, mit der potenzielle Mastitis-Erreger entdeckt wurden, war in Betrieben mit Melkstand ebenfalls tendenziell höher. Die Zwischendesinfektion der Vorbereitungsgeräte und der Zitzengummis erwies sich als vorteilhaft. In Bezug auf die Diversität mikrobieller Stämme, die für den Käseteig und die Käserinde typisch sind, gab es kaum Unterschiede zwischen AMS und Melkständen. Im Gegensatz dazu scheinen bestimmte Desinfektionsmittel, wie Milchsäure, die zur Desinfektion der Zitzen nach dem Melken verwendet wird, besser zur Erhaltung der für die Käseherstellung nützlichen Bakterien beizutragen. In der Studie wurde nicht untersucht, ob kontinuierlich eingesetzte AMS mit den Anforderungen an die für bestimmte AOP-Produkte festgelegten Spezifikation vereinbar sind, z. B. bezüglich der Begrenzung auf zwei Melkungen pro Tag, der Lieferung der Milch direkt nach dem Melken, der Lagerung der Milch in Kupferkessi und/oder bei Temperaturen von über 8 °C. Diese Kriterien werden von der betreffenden Branche individuell mit dem Ziel festgelegt, die erwünschte Typizität der Produkte zu wahren. Automatische Melksysteme (AMS) werden in der Schweizer Milchwirtschaft zunehmend genutzt, jedoch sind die Entscheidungsfaktoren für deren Einführung wenig erforscht. Diese Studie untersuchte soziale und psychologische Einflussfaktoren auf die AMS-Adoption, insbesondere im Kontext der AOP-Käsemilchproduktion, mittels einer quantitativen Umfrage und qualitativer Interviews. Die Ergebnisse zeigen, dass höhere Bildung, Digitalkompetenz und die Betriebsgröße eine Rolle spielen, während das Einkommen keinen signifikanten Einfluss hat. Die Interviews verdeutlichen, dass die Entscheidung für oder gegen AMS primär ökonomische und betriebsorganisatorische Gründe hat und weniger von AOP-Regularien abhängt. Insgesamt zeigt sich ein Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation, wobei beide Produktionsweisen die geforderte Milchqualität erreichen können. Welche Faktoren die Nutzung von Technologien in der Landwirtschaft beeinflussen, wurde schon in verschiedenen Studien untersucht. Die Wahrnehmung der KonsumentInnen wurde bisher hingegen weniger gut erforscht. Eine erste Studie in der Deutschschweiz mit 287 Personen zeigte, dass KonsumentInnen landwirtschaftliche Technologien grundsätzlich positiv bewerten (Mittelwert von 70.4 auf einer Skala von 0 = sehr negativ bis 100 = sehr positiv). Auch die automatischen Melksysteme (AMS) wurden bezüglich spontaner Assoziationen generell positiv wahrgenommen, es wurden aber auch Bedenken hinsichtlich des Tierwohls und der Beziehung zwischen Mensch und Tier geäussert. Eine zweite, grössere Studie mit 485 Personen, die sowohl in der deutsch- als auch in der französischsprachigen Schweiz durchgeführt wurde, bestätigte diese positive Wahrnehmung mit leichten regionalen Unterschieden. In der französischsprachigen Schweiz wurden beispielsweise für die Konsumbereitschaft von Produkten, die mittels AMS produziert wurden, mit 80.3 leicht höhere Mittelwerte als in der deutschsprachigen Schweiz mit 77.9 gemessen. Die Ergebnisse zeigen, dass gezielte Kommunikation notwendig ist, um KonsumentInnen besser zu informieren und ihr Vertrauen in neue landwirtschaftliche Technologien zu stärken.