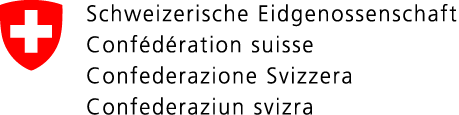Die Aleppo-Hirse hat sich im Tessin bereits etabliert und könnte sich mit dem Klimawandel weiter nach Norden ausbreiten. Ein neues Merkblatt von Agroscope zeigt, wie man die Art erkennt und ihre Verbreitung frühzeitig eindämmen kann.
Südlich der Alpen breitet sich die Aleppo-Hirse, auch Wilde Mohrenhirse genannt, seit einigen Jahren stark aus. Die konkurrenzkräftige, mehrjährige Pflanze bildet bis zu zwei Meter lange Rhizome und produziert bis zu 28 000 Samen pro Exemplar, die leicht über Erdmaterial, Schuhe oder Maschinen verschleppt werden. Nach der Etablierung kann die Aleppo-Hirse dichte Bestände mit viel Biomasse bilden.
Info Flora stuft die Art – ähnlich wie das Erdmandelgras – als potenziell invasiven Neophyten ein. Nun stellt Agroscope die Aleppo-Hirse in einem neuen Merkblatt vor und zeigt Bekämpfungsmassnahmen auf.
Probleme auf Landwirtschaftsflächen
In Österreich hat sich die Aleppo-Hirse seit 1990 stark ausgebreitet und kommt auf landwirtschaftlichen Flächen vor allem in Körnermais und Ölkürbis vor. In der Schweiz ist vor allem das Tessin betroffen. Dort breitet sich das hohe Gras vor allem in Weinbergen, auf Brach- und Ödland und im Randbereich von Mais-, Zucchetti- und Kartoffelfeldern aus.
Ausbreitung verhindern
Um die Ausbreitung der Aleppo-Hirse zu verhindern, sind Hygienemassnahmen zentral. Maschinen, Geräte und Traktorräder müssen direkt nach dem Einsatz auf befallenen Flächen gereinigt werden. Auch über Schuhe und Kleidung kann die Pflanze verbreitet werden. Schnittgut mit Blütenständen darf nicht auf den Kompost, sondern muss im Abfall oder – bei grösseren Mengen − über die kantonale Fachstelle entsorgt werden.
Bekämpfung aufwändig und teuer
Hat sich die Aleppo-Hirse etabliert, bleibt die Bekämpfung schwierig, denn die Samen und Rhizome können mehrere Jahre im Boden überdauern. Neben mehrmaligem Mähen mit Ausgraben der Rhizome können Herbizide wie Glyphosat eingesetzt werden. Auch klassische Graminizide oder ALS-Inhibitoren wirken, doch das Resistenzrisiko ist hoch.
Eine chemische Bekämpfung ist wirksamer, wenn sie mit weiteren Massnahmen – wie einer vielfältigen Fruchtfolge – kombiniert wird. Auch sollte eine befallene Fläche nicht lange brach liegen, sondern möglichst durchgehend bedeckt sein.
Anpassungsfähiger Neophyt
Die Aleppo-Hirse gedeiht besonders gut bei Wärme und Trockenheit und könnte vom Klimawandel profitieren. Ihre frostempfindlichen Rhizome profitieren von milden Wintern oder überleben in tieferen Bodenschichten. Wird die Pflanze gemäht, bildet die anpassungsfähige Art ihre Samen einfach näher am Boden.
Aleppo-Hirse erkennen
Die Aleppo-Hirse ist ein Süssgras der Gattung Sorghum und trägt den lateinischen Namen Sorghum halepense. Die Pflanze ist 60 cm bis 2 m hoch und kann sogar 3 m erreichen. Die Blätter sind bis zu 4 cm breit und bis zu 80 cm lang, glatt und tragen eine ausgeprägte weisse Mittelrippe, die typisch für die Art ist. Der Blütenstand besteht aus einer bis 30 cm langen, lockeren Rispe aus einblütigen Ährchen.