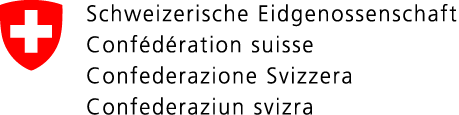Der Wassergehalt des von den Pflanzen produzierten Nektars kann variieren. Um seine Konservierung in den Waben zu gewährleisten, darf er nicht gären. Deshalb wird er von den Bienen in Honig umgewandelt, indem sie seinen Wassergehalt senken und folglich den Zuckergehalt erhöhen. Dies verhindert die Entwicklung der Mikroorganismen. In der Dunkelheit des Bienenstocks ist es schwierig, den Herstellungsprozess des Honigs zu beobachten. Aus diesem Grund ist er auch nur wenig erforscht. Um die Umwandlung von Nektar in Honig zu untersuchen, haben wir die Technik der Tomographie eingesetzt. Sie ermöglicht es, den Zuckergehalt des eingelagerten Nektars sehr präzise zu messen, ohne den Bienenstock öffnen zu müssen und das Bienenvolk zu stören.

Anina Gilgen
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Dr.
Forschungsgruppe
- 22.00.19.09 Integrative Agrarökologie
Funktion
Leiterin des Agrarumweltmonitorings
Agroscope-ID: 21211 Per E-Mail versenden
Anina Gilgen
Anina Gilgen
Projekte
- 22.14.19.09.01
Publikationen
Anina Gilgen
Tätigkeiten
An der ETH Zürich habe ich im Bereich Umweltnaturwissenschaften studiert und promoviert. Dadurch erlangte ich eine gute Allgemeinbildung im Bereich Umwelt sowie ein vertieftes Wissen im Bereich Atmosphäre und Klima. Ich kenne mich gut mit der statistische Auswertung von Forschungsergebnissen aus, habe Programmiererfahrung (bash, R, python) und spreche fliessend Englisch und nicht ganz so fliessend Französisch. ;-)
Seit November 2019 arbeite ich bei Agroscope, wo ich das Team "Agrarumweltmonitoring" leite. Wir sammeln und erheben Daten zu den Strukturen und dem Management landwirtschaftlicher Betriebe, die als Input für unsere Modelle dienen. Mit den Modellen berechnen wir sogenannte Agrarumweltindikatoren, mit denen wir aufzeigen können, wie sich die Wirkung der Landwirtschaft auf die Umwelt über die Zeit verändert. Beispiele für Agrarumweltindikatoren sind Treibhausgasemissionen, Risiken von Pflanzenschutzmitteln oder Schwermetallbilanzen. Diese Indikatoren dienen der Politik, aber auch der Gesellschaft im Allgemeinen als Informationsgrundlage für Entscheidungen. Durch diese sehr spannende Tätigkeit eignete ich mir ein breites Wissen über Umweltwirkungen in der Landwirtschaft an, das ich laufend vertiefe. Besonders reizvoll ist es, an der Schnittstelle zwischen der Forschung, der Politik und der Gesellschaft (inklusive Landwirtschaftsbetriebe) zu sein.
Neben meiner Hauptaufgabe, das Agrarumweltmonitoring zu leiten, bin/war ich auch in weitere Projekte involviert. Beispielsweise habe ich zusammen mit KollegInnen untersucht, wie man das heutige Direktzahlungssystem mithilfe von Agrarumweltindikatoren ausgestalten könnte. Des Weiteren arbeite ich zurzeit an Projekten im Bereich Agrarökologie. So haben KollegInnen und ich die FAO-Methode TAPE (Tool for Agroecological Performance Evaluation) in der Schweiz angewandt und im Bereich Biodiversität weiterentwickelt.