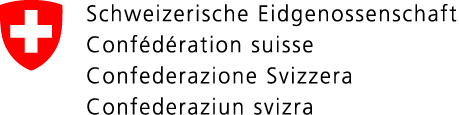Der Gesamtvorrat an organischem Kohlenstoff (total organic carbon − TOC) im Boden ist von zentraler Bedeutung für die landwirtschaftliche Produktivität, die Klimaregulation und die ökologischen Funktionen des Bodens. Er wird massgeblich durch Umweltbedingungen sowie durch landwirtschaftliche Bewirtschaftungspraktiken beeinflusst. Änderungen im TOC-Vorrat lassen sich häufig erst im Verlauf von Jahrzehnten quantifizieren. Langfristige Messprogramme wie die Nationale Bodenbeobachtung (NABO) ermöglichen es, solche Veränderungen zuverlässig zu erfassen. Während im Oberboden (0-20 cm) an über 100 NABO-Standorten in den letzten 30 Jahren keine Veränderungen festgestellt wurden, fehlen bisher Daten zur langfristigen Entwicklung des TOC-Vorrats im Unterboden. Grund dafür sind die spätere Einführung einer systematischen Tiefenbeprobung und Unterschiede in der Probenahme, Tiefeneinteilung, TOC-Analytik und Bestimmung der Lagerungsdichte im Vergleich zur ersten Erhebungsperiode der NABO (1985–1989). Ziel dieser Studie ist es daher, (i) die Daten der ersten (1985–1989) und siebten (2015–2019) Erhebung zur Berechnung des profilumfassenden TOC-Vorrats zu harmonisieren, (ii) Veränderungen des TOC-Vorrats in Abhängigkeit von der Landnutzung zu quantifizieren, (iii) den Einfluss pedoklimatischer Bedingungen auf den TOC-Vorrat und dessen Entwicklung zu analysieren sowie (iv) bestehende Limitationen der Datengrundlage zu identifizieren und Empfehlungen für künftige Erhebungen abzuleiten. Der TOC-Vorrat berechnet sich aus dem gemessenen TOC-Gehalt und der Lagerungsdichte des Bodens. Für 58 Standorte der Landnutzungen Ackerbau, Grasland, Obst-/Rebbau und Wald lagen annähernd vollständige Daten zum gemessenen TOC-Gehalt und zur Lagerungsdichte für beide Erhebungen vor. Zur Vergleichbarkeit der TOC-Vorräte wurden vier Harmonisierungsschritte durchgeführt: (1) Die TOC-Gehalte unterschiedlicher Messmethoden wurden mithilfe eines generalisierten linearen Modells vereinheitlicht, (2) fehlende Lagerungsdichten durch eine neu entwickelte Pedotransferfunktion geschätzt, (3) die Tiefenverteilung der Bodenparameter mittels massenerhaltender Spline-Interpolation bis 60 cm standardisiert und (4) ein Regressionsmodell zur Korrektur methodenbedingter Unterschiede in der Lagerungsdichte entwickelt. Die harmonisierten TOC-Vorräte sowie deren Änderungen wurden in Abhängigkeit von Landnutzung und Standortbedingungen mithilfe linearer Modelle ausgewertet. Zudem wurden die minimale nachweisbare Differenz des TOC-Vorrats, pedoklimatische Einflüsse und Unsicherheiten der einzelnen Harmonisierungsschritte quantifiziert. Der TOC-Vorrat betrug in der ersten und siebten Erhebung durchschnittlich 62 respektive 55 t TOC ha⁻¹ im Oberboden (0–20 cm) und 57 respektive 50 t TOC ha⁻¹ im Unterboden (20–60 cm). Im Oberboden von Ackerbaustandorten zeigte der TOC-Vorrat eine signifikante Abnahme über die Zeit; im Unterboden und innerhalb der anderen Landnutzungen war der Unterschied zwischen den Erhebungen statistisch nicht signifikant. Hier wären je nach Landnutzung und Bodentiefe 1.0–17.6 mal grössere Abweichungen erforderlich gewesen, um signifikante Veränderungen nachweisen zu können. Grasland wies im Oberboden einen 1.5-fach höheren TOC-Vorrat auf als Ackerland – vermutlich bedingt durch geringere Störungen des Bodens und höhere Wurzelbiomasse – während Wald-, Obst- und Rebbaustandorte dazwischen lagen. Im Unterboden wurden keine signifikanten Unterschiede im TOC-Vorrat zwischen den Landnutzungen festgestellt. Auf Acker-, Grasland- und Waldstandorten zeigte der TOC-Vorrat im Oberboden einen positiven Zusammenhang mit dem Tongehalt, was auf eine höhere Stabilisierung organischen Materials in feinkörnigen Böden hinweist. Je nach Landnutzung korrelierte der TOC-Vorrat im Unterboden positiv mit dem pH-Wert, der Höhenlage oder der Hangneigung. Die Änderung des TOC-Vorrats zwischen erster und siebter Erhebung stand primär in negativem Zusammenhang mit dem initialen TOC-Vorrat, was auf eine Zunahme bei zunächst niedrigen, und eine Abnahme bei zunächst hohem TOC-Vorrat schliessen lässt. Die Unsicherheiten in der Datenharmonisierung lagen bei jeweils 7–9% für die Schätzung fehlender Werte und Umrechnungen von Werten zwischen verschiedenen Bestimmungsmethoden sowie bei nur etwa 1% für die Tiefeninterpolation. Für das zukünftige Monitoring des TOC-Vorrats gelten Unterschiede in der Tiefeneinteilung von Unterbodenproben als unkritisch – vorausgesetzt, es kommen Spline-basierte Interpolationsverfahren zum Einsatz. Eine konsistente oder harmonisierte Methodik der Kohlenstoffanalytik und Bodendichtebestimmung sowie die Quantifizierung der kleinräumigen Variabilität und des tatsächlichen Skelettgehalts sind jedoch unerlässlich für belastbare, profilumfassende TOC-Berechnungen. Um den Einfluss von Bewirtschaftungsmassnahmen auf den TOC-Vorrat in Ackerböden und für ein nachhaltiges Bodenmanagement in der Schweiz fundiert bewerten zu können, sollten künftig neben pedoklimatischen Bedingungen auch Informationen zur Bodenbewirtschaftung systematisch in die Datenauswertung einbezogen werden.